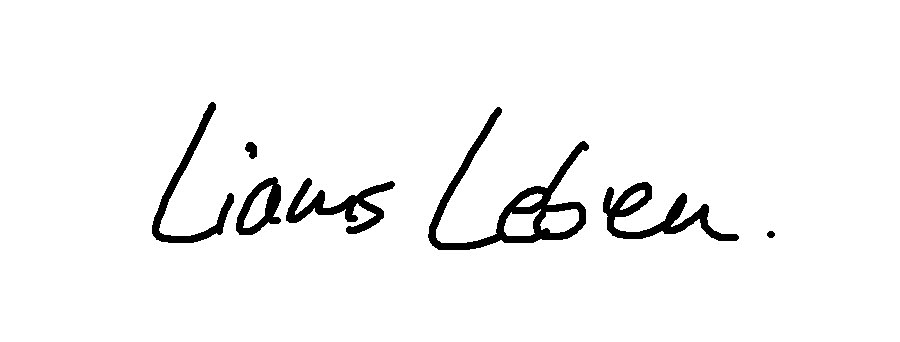Ich gehe ein letztes Mal durch die Stadt und spüre mein Scheitern überall.
Ich sehe es in dem Laub auf dem Boden, das wehend durch die Gassen fliegt. Ich sehe es in den Pflastersteinen auf dem Campus, in den Ritzen dazwischen und in den kleinen und größeren Bodenwellen. Und in dem Schild "Achtung, Gehwegschäden!", das vor eben jenen warnt.
Ich rieche mein Scheitern in der Luft, in den Abgasen der Autos und in dem modrigen Duft nach Herbst. Ich sehe es in den rosanen Wolken, die sich vor dem babyblauen Himmel in bunten Formationen anreihen. Wetter, das so gar nicht zu meiner Stimmung zu passen scheint. Und trotzdem untermalt es die nur noch mehr.
Die Vögel zwitschern mein Scheitern in die Welt hinaus, das wütende Hupen der Autofahrer geleitet mich und ich will es mir aus der Seele schreien: "Ja, ich gehe! Diese Stadt war nichts für mich!"
Freitag, 17. November 2017
Sonntag, 27. November 2016
In mir.
In mir ist alles voll. Ich bin aufgefüllt vom Kopf bis in die Zehen. Jeder Hohlraum, jedes Organ und jedes Blutgefäß ist voll davon. Alles einnehmend. Jede Zelle ist besetzt. Überall ist sie. Leere. Ich bin voll mit Leere.
In meinem Inneren ist nichts. Alles ist taub und still. Alles ist voller Widersprüche, voller unausgesprochener Worte und ungedachter Gedanken. Sie sind dadrin. Irgendwo in mir. Und sie kommen nicht raus.
Irgendwas ist da, aber es scheint doch nichts zu sein.
Ich würde mich gerne aufreißen, um nachzuschauen. Ich würde gerne alles sehen, was in mir ist. Das Monster fangen, was mich gefangen hält, um es mit bloßen Händen zu zerstören. Es versteckt sich hinter all dem Nichts, es kommt nicht raus, vielleicht ist es das Nichts. Wer weiß das schon.
In mir ist nur Leere.
Aber irgendwas ist da. Ich spüre es.
In meinem Inneren ist nichts. Alles ist taub und still. Alles ist voller Widersprüche, voller unausgesprochener Worte und ungedachter Gedanken. Sie sind dadrin. Irgendwo in mir. Und sie kommen nicht raus.
Irgendwas ist da, aber es scheint doch nichts zu sein.
Ich würde mich gerne aufreißen, um nachzuschauen. Ich würde gerne alles sehen, was in mir ist. Das Monster fangen, was mich gefangen hält, um es mit bloßen Händen zu zerstören. Es versteckt sich hinter all dem Nichts, es kommt nicht raus, vielleicht ist es das Nichts. Wer weiß das schon.
In mir ist nur Leere.
Aber irgendwas ist da. Ich spüre es.
Montag, 21. November 2016
Willkommen zurück.
Wie wenn du davonläufst und du rennst und rennst und rennst und du bist ganz aus der Puste, aber verdrängst alles aus dem Kopf. Nur der Weg nach vorne zählt. Und jeder Schritt ist ein großer Sprung und die Welt links und rechts fliegt vorbei. Bis zu diesem Moment, in dem du dich umdrehst. Du blickst deinem Verfolger in die Augen. Du siehst, er ist noch da. Und mit diesem einen Moment ist alles vorbei. Du drehst den Kopf zwar schnell wieder nach vorne und läufst weiter, aber auf einmal ist alles anders. Deine Füße tragen dich nicht mehr. Dein Blick schweift hin und her und du spürst auf einmal diesen Atem hinter dir und du willst nur weg, aber du kannst nicht mehr.
Und wenn du fällst. Dann ist er über dir. Dann verschlingt er dich. Dein Schatten. Dein ewiger Feind. Dein alter Freund.
Ich bin zurück dort, wo ich nie mehr sein wollte.
Zurück in dem Teil der Welt, wo Schmerz vorgaukelt, Erlösung zu sein. Rot auf weiß bildet Muster, bildet Monster, bildet etwas aus mir.
Diese Stille in mir, die schreit und schreit und schreit. Dieses Leben in mir. Es ist da. Ich finde es nur gerade nicht.
Dieser Teil von mir ist immer noch da. Und der Schmerz ist auch noch derselbe. Alles beim Alten.
Willkommen zurück. Ich war nur mal kurz weg.
Ich habe dich vermisst. Oder vielleicht auch nicht.
Und wenn du fällst. Dann ist er über dir. Dann verschlingt er dich. Dein Schatten. Dein ewiger Feind. Dein alter Freund.
Ich bin zurück dort, wo ich nie mehr sein wollte.
Zurück in dem Teil der Welt, wo Schmerz vorgaukelt, Erlösung zu sein. Rot auf weiß bildet Muster, bildet Monster, bildet etwas aus mir.
Diese Stille in mir, die schreit und schreit und schreit. Dieses Leben in mir. Es ist da. Ich finde es nur gerade nicht.
Dieser Teil von mir ist immer noch da. Und der Schmerz ist auch noch derselbe. Alles beim Alten.
Willkommen zurück. Ich war nur mal kurz weg.
Ich habe dich vermisst. Oder vielleicht auch nicht.
Sonntag, 9. Oktober 2016
Ein Moment der Ruhe.
Ein Moment der Ruhe, was gäbe ich dafür?
Ein Moment, in dem die Welt da draußen schweigt. Keine Züge, die über die Schienen rattern, keine wütend hupenden Autos, keine Menschen, die vor meinem Fenster lachen und rufen und ihr Leben leben. Keine Flugzeuge und keine Kinder, keine Kirchenglocken und auch kein prasselnder Regen auf dem Dach. Nur Ruhe. Ruhe. Ruhe.
Doch auch dann wäre es mir noch zu laut, denn in mir tobt es weiter. Die Gedanken rasen und sie sprechen miteinander, verwerfen sich gegenseitig, sie schreien sich an und weinen. Mein Kopf droht zu platzen, denn die Stimmen jagen sich gegenseitig durch mich hindurch, stoßen beim Ringen und Raufen an die Knochen und schmerzen mich. Es explodiert und es knallt, es brennt in meinem Kopf. Zu viel Lärm und zu viel Kampf.
Egal ob es draußen still ist oder laut, ob ich alleine sitze oder unter Menschen lache, ob ich wach bin oder schlafen will, in mir ist es niemals leise.
Hört ihr das nicht auch, seid doch mal still, verdammt!
Ein Moment der Ruhe, was gäbe ich nur dafür?
Samstag, 27. Juni 2015
Rasender roter Zeiger auf weißer Wand.
Der rote Sekundenzeiger blitzt vor meinen Augen auf, auch
wenn ich sie fest verschließe. Der kleine Scheißer ist so verdammt
aufdringlich. Mit hämmerndem Ticken setzt er Sekunde für Sekunde einen Schritt
und schreit mir ins Ohr, wie die Zeit vergeht. Er brüllt lauter als die
piepsenden Monitore und die ratternden Tragen auf dem Gang, lauter als die
lauten Stimmen der Pfleger und Krankenschwestern und Ärzte, als die Schreie der
Patienten, die immer mal wieder zu mir durchdringen. Um mich herum herrscht
Lärm in der Notaufnahme, aber alles, was ich höre, ist dieser rote
Sekundenzeiger. Und alles, was ich sehe, ist weiße sterile Wand und die
Bewegungen des kleinen Zeigers. Mein Blickfeld ist eingeschränkt, mein Körper
liegt verdreht auf dem Bett und meine Welt schrumpft auf dieses Bild: Rasender
roter Zeiger auf weißer Wand. Endlose Kreisbewegungen. Pi mal irgendwas hoch
zwei und ich kann berechnen, wie viel Strecke der rote Blitz am Tag zurücklegt.
Oder auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ich konzentriere mich auf nichts,
auf alles, auf irgendwas. Nur um nicht verrückt zu werden. Ich schaue die ganze
Zeit schon auf die Uhr und beobachte den Zeiger und weiß trotzdem nicht, seit
wann ich hier bin. Es kommt mir vor wie Stunden, aber irgendwie auch erst wie
Minuten, vielleicht auch Sekunden oder ich bin gar nicht wirklich hier. Zeit und Raum
schrumpfen zusammen und es bleibt mir nur Liegen und Atmen und das ewige Kreisen
des roten Zwergs. Was interessiert mich
auch die Zeit, ich hab ja eh nichts mehr vor. Nur warten und warten und warten.
Menschen betreten den Raum, in dem ich liege. Ich höre sie. Aber ich kann sie
nicht sehen. Sie grüßen mich nicht, sagen nichts zu mir, laufen nur gehetzt
durch die Gegend. Ich bin Luft. Vielleicht habe ich mich wirklich schon
aufgelöst. Vielleicht wird das Zimmer gleich nochmal belegt. Eine Schwester
betritt den Raum, eine alte Dame am Arm. Wenn Sie sich jetzt kurz hier hinlegen
würden, Frau Werauchimmer. Ruhen Sie sich aus, der Doktor wird gleich bei Ihnen
sein. Wie lange das dauert, fragen Sie? Da kann ich Ihnen leider gar nichts zu
sagen. Da kann immer ein Notfall dazwischenkommen. Aber der Doktor weiß
Bescheid. Na klar. Jeder weiß hier Bescheid. Nur ich nicht. Man redet ja nicht
mit mir. Aber das ist mir auch egal. Ich versuche, den flitzenden roten
Sekundenzeiger mit meinem inneren Willen zum Stillstand zu bewegen. Ich rede
ihm gut zu und tatsächlich verlangsamt er seine Bewegungen. Nur um dann wieder
schneller zu werden und seine Runde monoton fortzusetzen, als hätte er mich gar
nicht bemerkt. Verrückt. Ist das hier. Ich glaube, ich liege schon zu lange
hier. Ich glaube, ich verliere zu viel Blut. Hallo Herr Doktor, wissen Sie
Bescheid? Ich liege hier und werde verrückt. Nein, das kann nicht sein. Ich bin
ja schon verrückt. Die pulsierende Wunde an meinem linken Arm erinnert mich
daran. Oh, wie ist denn das passiert? Mh, selbstverletzt. Oh, achso, rollende
Augen und schnelle Schritte, etwas Abstand, niemand ist zuständig hier. Also
außer meinem Freund, der gute Kleine, der schöne Rote, der schnelle Läufer, der
zeitanzeigende rote Blitz. So oft wie er schon zugeschaut hat, wie viele
Krankheitsgeschichten er schon in sich aufgesogen hat, wie viele einsame Seelen
schon ihn als einzigen Freund gewählt haben. Er wird schon wissen, wie das
geht. Ein bisschen Blutung stillen hier, ein paar Stiche setzen da, zukleben,
verbinden, die obligatorischen Fragen, Aber das ist nicht in suizidaler Absicht
geschehen? Aber in Therapie sind Sie, ja? Fäden ziehen in 12 Tagen, die Wunde
bitte sauber und trocken halten, den Arztbrief erhalten Sie dann gleich und
bitte sobald wie möglich zum Hausarzt, ja vielen Dank, auf Wiedersehen. Husch
husch, der nächste Patient wartet schon. Huch, wer ist denn da gerade in
wallendem weißen Mantel aus dem Zimmer gehuscht? War das etwa der Arzt? Bin ich
etwa schon fertig? Ich blicke den roten Sekundenzeiger fragend an, aber der
läuft nur weiter seine Runden, ignoriert mich eiskalt. Arroganter Mistkerl. Nach einem kurzen Zögern
richte ich mich vorsichtig auf, suche meine Sachen zusammen und verlasse
langsam trabend das Behandlungszimmer, die Notaufnahme, das Krankenhaus. Keine
Alarmglocken schrillen. Die Nacht empfängt mich kalt und dunkel. Ein kleiner
roter Strich, der ständig vor meinem Auge aufblitzt und Reigen tanzt, und ein
stechender Schmerz im linken Arm sind die einzigen Andenken dieser Nacht.
Sonntag, 17. August 2014
Weggabelung der Entscheidung.
Die Weggabelung der Entscheidung tut sich vor dir auf. Du verlangsamst deine Schritte, um mehr Zeit zum Denken zu haben. Zum Überlegen, welche Richtung wohl die beste ist. Zum Grübeln über diese und jene mögliche Konsequenz. Du versinkst in den Gedanken des Für und Wider, im ewigen Hin und Her. Am Ende stehst du fast. So langsam bist du geworden. Wie in Zeitlupe. Aber der Lauf des Lebens gibt dir vor, dass du nicht stehenbleiben kannst. Es geht nicht. Kein Zurück und kein Stopp. Die Kreuzung wird kommen, auch wenn du noch so langsam schleichst. Es sei denn, du springst ab. Dann ist Stopp. Aber endgültig. Kein Zurück. Das ewige Ende im endlosen Nichts. Kurz denkst du tatsächlich darüber nach. In diesen Momenten, in denen die Last der Entscheidung dich niederzudrücken scheint. Wenn alles zu viel wird, weil du verdammt nochmal einfach nicht weißt, welcher scheiß Weg der richtige ist und welcher der falsche, welcher vielleicht eine Sackgasse ist oder bei welchem sich unüberwindbare Hindernisse hinter der nächsten Kurve verbergen. Woher sollst du es auch wissen, woher? Aber nein, das ist keine wirkliche Option, ein Gedankenspiel, nichts weiter. Nicht wahr? Und in dir beginnt es zu rasen, deine Gedanken entziehen sich jeder Logik, du kannst jetzt nicht so etwas Wichtiges entscheiden, nicht jetzt! Aber du musst, du musst jetzt, denn da ist die Gabelung, du hast sie erreicht, und du biegst ab, du musst. Nach links. Vielleicht. Oder nach rechts. Wer weiß schon, wie du entscheidest.
Und kaum abgebogen drehst du auch schon den Kopf. Du schaust zurück und überdenkst diesen entscheidenden Schritt in die Richtung wieder und wieder und wieder und immer wieder laufen dir die Bilder durch den Geist. Die Kreuzung liegt schon weit hinter dir und trotzdem lässt sie dich nicht los. Deine Gedanken kreisen weiter nur um diesen Moment. So sehr, dass du den Weg nach vorne vergisst. Du fragst dich, wo du jetzt wohl stehen würdest, hättest du den anderen Pfad gewählt. Besser. Vielleicht. Oder doch schlechter. Wer weiß schon, was gewesen wäre.
Und dann brüllst du in den dunklen Wald hinein: Ich habe mich doch entschieden, verdammt! Kann mir dann nicht wenigstens einer sagen, ob es richtig war? Was für ein Scheiß! Eine Frage ohne Antwort! Ein Problem ohne Aufklärung!
Wie ein Buch, in dem das letzte Kapitel ungeschrieben bleibt. Eine unvollendete Geschichte. Es wird dich immer verfolgen, immer.
Es sei denn, du schreibst es selbst.
Und kaum abgebogen drehst du auch schon den Kopf. Du schaust zurück und überdenkst diesen entscheidenden Schritt in die Richtung wieder und wieder und wieder und immer wieder laufen dir die Bilder durch den Geist. Die Kreuzung liegt schon weit hinter dir und trotzdem lässt sie dich nicht los. Deine Gedanken kreisen weiter nur um diesen Moment. So sehr, dass du den Weg nach vorne vergisst. Du fragst dich, wo du jetzt wohl stehen würdest, hättest du den anderen Pfad gewählt. Besser. Vielleicht. Oder doch schlechter. Wer weiß schon, was gewesen wäre.
Und dann brüllst du in den dunklen Wald hinein: Ich habe mich doch entschieden, verdammt! Kann mir dann nicht wenigstens einer sagen, ob es richtig war? Was für ein Scheiß! Eine Frage ohne Antwort! Ein Problem ohne Aufklärung!
Wie ein Buch, in dem das letzte Kapitel ungeschrieben bleibt. Eine unvollendete Geschichte. Es wird dich immer verfolgen, immer.
Es sei denn, du schreibst es selbst.
Mittwoch, 6. August 2014
Was früher mein Zuhause war.
Der Zug bremst quietschend ab, bis er im Bahnhof zum Stehen kommt. Die Türen öffnen sich und ich atme die regnerische Luft ein. Kurz muss ich mich orientieren, folge dann den wenigen Leuten, die mit mir ausgestiegen sind und verlasse den Bahnsteig. Ich biege an der Straße links ab, durch den Tunnel und dann den Fußweg entlang. Ich versinke in meinen Gedanken, aber meine Füße kennen den Weg und tragen mich über Kreuzungen, Zebrastreifen und Bürgersteige bis zu der Straßenecke, an der ich abbiegen muss. Ich verlangsame mein Tempo und tauche aus meiner Gedankenwelt auf. Die letzten Schritte lege ich langsamer zurück und ich blicke mich dabei um. Ich schaue nach links und nach rechts, betrachte die Bäume und die Straßenlaternen, die Hecken und die Gartentore der Nachbarn.
Und dann sehe ich das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Es ist mit Efeu überwachsen, so wie auch früher schon. Ein Auto steht vor der Tür, wie auch damals oft. Der Briefkasten hängt links von der Tür, der gepflasterte Weg ist gefegt und leer. Ich kenne es hier und trotzdem fühle ich mich fremd. Obwohl ich noch einen Schlüssel in der Tasche habe, klingele ich. Ich käme mir wie ein Einbrecher vor, würde ich ungefragt das Haus betreten.
Als die Tür geöffnet wird, trete ich ein. Ich sehe mich um. Irgendwie sieht alles so aus, wie ich es kenne. Die Wände sind in derselben Farbe gestrichen. Der Tisch und die Stühle sind noch die alten. Und trotzdem wirkt alles so fremd. Hier hängt ein neues Bild. Der Toaster ist neu und auch der Wasserkocher. Es liegen Dinge herum, die ich noch nie gesehen habe. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll, während mein Blick durch das Zimmer schweift. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Frage ich nach etwas zu trinken oder hole ich es mir selber. Gehe ich aufs Gästeklo oder benutze ich die Toilette im oberen Stockwerk.
Als ich mein Handy aus der Hosentasche ziehe, um mich abzulenken und festzuhalten, wundere ich mich. Ich habe WLAN. Das Smartphone hat sich automatisch mit dem privaten Netzwerk verbunden, denn die Daten waren wohl noch eingespeichert. Ein Home-Netzwerk. Vielleicht ist das das einzige, was noch geblieben ist. Was früher mein Zuhause war, ist heute nur noch WLAN-Netz.
Und dann sehe ich das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Es ist mit Efeu überwachsen, so wie auch früher schon. Ein Auto steht vor der Tür, wie auch damals oft. Der Briefkasten hängt links von der Tür, der gepflasterte Weg ist gefegt und leer. Ich kenne es hier und trotzdem fühle ich mich fremd. Obwohl ich noch einen Schlüssel in der Tasche habe, klingele ich. Ich käme mir wie ein Einbrecher vor, würde ich ungefragt das Haus betreten.
Als die Tür geöffnet wird, trete ich ein. Ich sehe mich um. Irgendwie sieht alles so aus, wie ich es kenne. Die Wände sind in derselben Farbe gestrichen. Der Tisch und die Stühle sind noch die alten. Und trotzdem wirkt alles so fremd. Hier hängt ein neues Bild. Der Toaster ist neu und auch der Wasserkocher. Es liegen Dinge herum, die ich noch nie gesehen habe. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll, während mein Blick durch das Zimmer schweift. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Frage ich nach etwas zu trinken oder hole ich es mir selber. Gehe ich aufs Gästeklo oder benutze ich die Toilette im oberen Stockwerk.
Als ich mein Handy aus der Hosentasche ziehe, um mich abzulenken und festzuhalten, wundere ich mich. Ich habe WLAN. Das Smartphone hat sich automatisch mit dem privaten Netzwerk verbunden, denn die Daten waren wohl noch eingespeichert. Ein Home-Netzwerk. Vielleicht ist das das einzige, was noch geblieben ist. Was früher mein Zuhause war, ist heute nur noch WLAN-Netz.
Abonnieren
Posts (Atom)